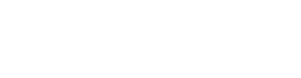Erster Weltkrieg, Nazizeit, Exil:
Das Schicksal einer vorbildlichen Ärztin, Dr. Annemarie Bieber
Dr. med. Annemarie Bieber, Schwester meiner angeheirateten Tante Elsbeth Bieber-Schaper, war für mich von Kindheit an das Vorbild einer praktischen Ärztin. Ihre Persönlichkeit und Lebensbewältigung kann all diejenigen Ärztinnen ermutigen, die mit Behinderungen durch ihre Umwelt zu kämpfen haben.
Dr. Bieber bestach mit ihren wissenschaftlich fundierten Kenntnissen und ihrem praktischen, Patienten als ganze Menschen einbeziehenden Verstand. Ich habe sie nicht persönlich gekannt, aber bewundert – wie alle in meiner ärztlich geprägten Familie. Wir kannten viele Geschichten aus ihrem Leben und haben oft ihre praktischen Therapie-Empfehlungen in unser eigenes Handeln integriert.
Die Bedeutung von Dr. Annemarie Bieber für Frauen im Arztberuf wurde mir jedoch erst richtig bewusst durch den Nachruf, den ihre Tochter Hanna Parker-Bieber 1957 verfasste. Er ist im Privatbesitz. Dr. Bieber kommt auch in der Literatur mehrfach vor. So in „Ärztinnen aus dem Kaiserreich“ von Prof. Dr. med Johanna Bleker und Dr. Sabine Schleiermacher und in dem Buch von Hilde Schramm über Dr. Dora Lux, die Schwester von Annemarie Bieber. Die hier geschilderte Biografie basiert auf diesen Quellen.
Politisch engagiert und für Frauen im Einsatz
Sozialdemokratisch und liberal eingestellt, arbeitete Dr. Bieber von 1911 bis 1938 in Berlin als niedergelassene praktische Ärztin, Gynäkologin und zeitweilige Chirurgin. „Rund um den Alexanderplatz“, hieß es in meiner Familie. Von 1912 (1914?) bis 1915 leitete sie mit Hermine Heusler Edenhuizen die neue „Poliklinik für Frauen“ bis zu deren Schließung. Diese Poliklinik war 1911 von Hermine Heusler-Edenhuizen und Martha Wygodzinski gegründet worden, unterstützt durch die Krankenhilfskasse des Berliner Frauenvereins. Patientinnen bezahlten dort nur den symbolischen Beitrag von 10 Pfennig.
Das Arbeitsverbot der Nazis hielt sie nicht ab
Annemarie Bieber heiratete den Rechtsanwalt Dr. Richard Bieber und bekam 1924 und 1926 zwei Töchter. In den 1930er-Jahren veränderte sich ihr Leben grundlegend. 1933 wurde ihr von den Nazis die Zulassung zu den Krankenkassen entzogen. Daher durfte sie ab 1933 nur noch Privatpatienten behandeln. Was dazu führte, dass sie eine Vorliebe für „Tee-Nachmittage“ entwickelte. Sie ging dorthin täglich mit übervoll beladenen Manteltaschen, wenngleich auf diese Aktivitäten die Todesstrafe gestanden haben soll. 1936 starb ihr Mann. 1938 erfolgte der Approbationsentzug und Dr. Bieber beantragte, in die USA auswandern zu dürfen.
Als Immigrantin wieder Ärztin
Sie zog um in den New York State, wo sie mit nun 58 Jahren eine Praxisvertretung für einen Militärarzt in Woodstock erhielt, nachdem sie Autofahren gelernt und einen Führerschein erhalten hatte. Jahre später, als sie Mitte 60 war, kam der Militärarzt zurück.
Sie adoptierte bald Ort und Landschaft
Ihr neues Landleben unterschied sich grundlegend vom quirligen und verfeinerten Lebensstil in der Großstadt Berlin. Doch sie nahm es an, denn sie war niemand, der in der Vergangenheit lebt. Die Wälder und Berge, die Bauern, Fischer und Jäger wurden ihre Leute. Sie interessierte sich weiterhin lebhaft für die aktuellen Ereignisse und liebte es, in ihren kurzen Freizeiten Politik, Kunst, Geschichte und griechische Mythologie zu diskutieren. Genauso sah sie sich aber den jeweils aktuellen Wildwest-Film an und sprach darüber mit den Leuten.
Dienst an der Menschheit kennt keine geographischen Grenzen
Wie ihre Tochter im Nachruf schrieb: „She was a woman who succeeded and achieved, not in the glare of fame, but simply making the best of herself, wherever she happened to be. I believe that – as far as is given to any of us – Dr. Marie Bieber was truly the master of her fate, the captain of her soul.”
Zur Autorin dieses Beitrags:
Prof. Dr. med. Monika Barthels ist Fachärztin für Innere Medizin und Kinderheilkunde. Ab 1969 baute sie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) den Arbeitsbereich für Blutgerinnungsstörungen auf und leitete ihn bis 1999 als Professorin. Von 1989 bis 1999 arbeitete sie als Frauenbeauftragte der MHH an Verbesserungen der Lage von Frauen in der universitären Medizin.
Dr. Bieber bestach mit ihren wissenschaftlich fundierten Kenntnissen und ihrem praktischen, Patienten als ganze Menschen einbeziehenden Verstand. Ich habe sie nicht persönlich gekannt, aber bewundert – wie alle in meiner ärztlich geprägten Familie. Wir kannten viele Geschichten aus ihrem Leben und haben oft ihre praktischen Therapie-Empfehlungen in unser eigenes Handeln integriert.
Die Bedeutung von Dr. Annemarie Bieber für Frauen im Arztberuf wurde mir jedoch erst richtig bewusst durch den Nachruf, den ihre Tochter Hanna Parker-Bieber 1957 verfasste. Er ist im Privatbesitz. Dr. Bieber kommt auch in der Literatur mehrfach vor. So in „Ärztinnen aus dem Kaiserreich“ von Prof. Dr. med Johanna Bleker und Dr. Sabine Schleiermacher und in dem Buch von Hilde Schramm über Dr. Dora Lux, die Schwester von Annemarie Bieber. Die hier geschilderte Biografie basiert auf diesen Quellen.
Politisch engagiert und für Frauen im Einsatz
Annemarie Bieber wurde am 18.02.1884 in Schneidemühlen Hammer in Ostpreußen als drittes von fünf Kindern geboren. Dank der Unterstützung ihres Vaters konnte sie Ärztin werden. Mit 17 Jahren machte sie Abitur, nachdem sie den „Gymnasialkurs für Frauen in Berlin“ absolviert hatte, der von der Politikerin und Frauenrechtlerin Helene Lange gegründet worden war. Mit 21 Jahren absolvierte sie 1905 ihr medizinisches Staatsexamen und promovierte 1906 in Freiburg über „Ein Beitrag zur rezidivierenden Glaskörperblutung und ihrer Behandlung durch Carotisligatur“. Sie wurde in rascher Folge Assistenzärztin in der Inneren Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, teils als einzige Ärztin. Widerstand erlebte sie vor allem von Schwestern im Krankenhaus.
Das Arbeitsverbot der Nazis hielt sie nicht ab
Ferner war Dr. Bieber aktiv in der Gesundheitspolitik in Berlin- Schöneberg, unter anderem als Fürsorgeärztin. 1932 wurde sie als Kandidatin der „Sozialistischen Ärzte“ für die Wahlen zum Ausschuss des „Groß-Berliner-Ärztebundes“ gewählt und war tätig im „Verein sozialistischer Ärzte“, dem „Bund Deutscher Ärztinnen“ (heute: DÄB), sowie der „Berliner Medizinischen Gesellschaft“ und im „Hartmann-Bund“.
Sie publizierte mehrere Artikel, so: „Die sittliche Forderung“, Mschr Dtsch Ärztinnen 6: 249 (1930); „Die Stellung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie zur Frau der werktätigen Bevölkerung“ Soz. Arzt 7: 335 ff (1931); „Der Vertragsentwurf zwischen der Stadt Berlin und dem Groß-Berliner-Ärztebund betr. die ärztliche Versorgung der Wohlfahrtskranken“ In „Die Ärztin“ 8: 130-132 (1932).
Als Immigrantin wieder Ärztin
Im April 1940 erhielt Dr. Bieber schließlich das erhoffte Visum unter der Voraussetzung, ihren gesamten Besitz in Nazi-Deutschland zurückzulassen. Mit 56 Jahren kam sie nach New York: mit ihren beiden Töchtern, drei Essbestecken, ihrem Instrumenten-Koffer und 3 Dollars. Nach Auffassung der zuständigen Behörden sollte sie dort zurückgezogen leben und zum Beispiel als Krankenschwester arbeiten. Sie widersprach energisch und lernte zunächst, finanziell unterstützt von Freunden, Englisch.
Dann der nächste Schlag mit der Mitteilung, dass für sie keine staatliche medizinische Prüfung erfolgen könne, da es schwer sei, als Frau medizinisch-praktisch zu arbeiten. Sie antwortete höflich, dass sie zwar für die meisten Dinge viel tun könne, aber vermutlich nicht ihren natürlichen Status als Frau ändern.
Sie adoptierte bald Ort und Landschaft
So zog sie nun in den kleinen Ort Phoenicia in den Catskill Mountains und lebte dort allein in einem Hotel, in dem sie auch ihre Praxis hatte. Ihre Tochter beschreibt diese Zeit so: „Sie adoptierte bald Ort und Landschaft, welche rasch sie ihrerseits adoptierten, eine kleine untersetzte Figur mit weissen Haaren und einer tiefen, beruhigenden Stimme“. Oft soll sie nachts gerufen worden sein, um mit ihrem Auto bei Wind und Wetter Patienten aufzusuchen.
Einmal wollte sie, bereits 70-jährig, einem abgestürzten jungen Bergkletterer helfen. Dazu hätte sie die Wand hinunterklettern müssen. Nur ein brachialer Polizeieinsatz konnte sie davon abhalten.
Dienst an der Menschheit kennt keine geographischen Grenzen
Sie hatte ein unersättliches Lebensbedürfnis, aber die Jahre des Stresses und des Kampfes wirkten sich aus und ihre Kräfte ließen nach. Als die „New York Medical Society“ sie für 50 Jahre Arbeit für die Öffentlichkeit ins Rampenlicht stellen wollte, erwiderte sie, dass der meiste Teil ihrer Arbeit nicht in den USA sondern anderswo geleistet wurde. Woraufhin die Medical Society antwortete, dass der Dienst an der Menschheit keine geographischen Grenzen kenne. Kurze Zeit darauf musste sie aus gesundheitlichen Gründen ihre Praxis aufgeben und behandelte nur noch die Familie ihrer Tochter. Wenige Monate später starb sie an Krebs.
Zur Autorin dieses Beitrags:
Prof. Dr. med. Monika Barthels ist Fachärztin für Innere Medizin und Kinderheilkunde. Ab 1969 baute sie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) den Arbeitsbereich für Blutgerinnungsstörungen auf und leitete ihn bis 1999 als Professorin. Von 1989 bis 1999 arbeitete sie als Frauenbeauftragte der MHH an Verbesserungen der Lage von Frauen in der universitären Medizin.
Mehr zum Thema